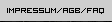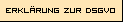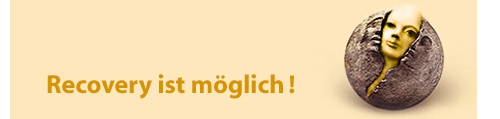|
[size=150]GAMMA(A) und GAMMA(B) für Dummies
So nahe liegen Medikament und Droge beieinander[/size]
Gamma-Hydroxybutyrat (GHB) wird wegen seiner stimulierenden und enthemmenden Wirkung illegal als Droge konsumiert. Mit dieser Substanz sammeln Forschende des Departements für Klinisch-Biologische Wissenschaften (DKBW) der Universität Basel neurobiologisches Grundlagenwissen, das der Entwicklung neuer Medikamente gegen psychische Krankheiten dienen soll. Der Missbrauch von GHB hat in den letzten Jahren stark zugenommen:
So finden sich im Internet etliche Websites, auf denen Pro und Kontra der Droge debattiert werden, und sogar Rezepte und Do-it-yourself-Kits sind im Angebot. Bodybuilder missbrauchen den Wirkstoff zum Muskelaufbau, weil er den Schlaf-Wach-Rhythmus und damit das Wachstumshormon beeinflusst, das die Muskeln schwellen lässt. Vor allem aber hebt GHB die Stimmung und beruhigt bei Stress. Oft als ungefährlich angepriesen, wird es deshalb in der Partyszene gerne zusammen mit Alkohol konsumiert. Doch gerade in dieser Kombination und in hohen Dosen kann es zu Koma oder sogar Atem- und Kreislaufstillstand führen, und erste Todesfälle sind bekannt. Äußerst negative Schlagzeilen hat der Stoff auch als „Date rape drug” gemacht: Die farblose und nur leicht salzige Substanz lässt sich leicht in Getränke schmuggeln, was einzelne gewissenlose männliche Zeitgenossen dazu ausnutzen, Frauen wehrlos zu machen, um sie zu vergewaltigen. In den USA werden die Drinks in vielen Bars deshalb nur noch abgedeckt serviert, und Poster an den Wänden warnen vor den Gefahren des „flüssigen Ecstasy”. Hoffnung auf neue Medikamente Die Wissenschaft kennt GHB seit den 1960er-Jahren. Die Substanz ist gut untersucht, trotzdem wusste bis dato niemand genau, wie sie eigentlich wirkt.
Die Forschung hat mehrere so genannte Rezeptoren – empfindliche Stellen auf den Nervenzellen des Gehirns – identifiziert an denen die Substanz ansetzt, konnte aber nicht sagen, welche von ihnen die beobachteten Effekte auf Körper und Psyche erzeugen. Basler Wissenschaftler haben diese Frage jetzt beantwortet: Prof. Bernhard Bettler und seine Mitarbeiter am Pharmazentrum züchteten dazu mit gentechnischen Methoden so genannte „Knockout-Mäuse”, denen einer der Rezeptoren fehlt, der so genannte GABAB-Rezeptor. Tiere ohne diese Rezeptoren zeigen im Gegensatz zu normalen Mäusen keinerlei Reaktion selbst auf hohe Dosen von GHB. Bettler vermutet deshalb, dass viele bekannte Effekte des Wirkstoffs über diesen einen Rezeptor vermittelt werden. Das noch unveröffentlichte Resultat der Arbeitsgruppe war eine Überraschung – und eine kleine Enttäuschung. Überraschend war es, weil die Wissenschaftler erwartet hatten, zumindest ein Teil der Wirkung sei anderen, noch nicht genau charakterisierten Andockstellen im Gehirn zuzuschreiben. Enttäuscht waren die Forscher, weil sie gerne mehr über die Funktion dieser anderen GHB-Andockstellen erfahren hätten, um neue, speziell darauf zugeschnittene Medikamente entwickeln zu können. Welche Effekte dort vermittelt werden, bleibt weiterhin unklar.
Der GABAB-Rezeptor ist dagegen wieder ins Rampenlicht gerückt.
Vor fünf Jahren wurde er als letzter wichtiger Rezeptor für Botenstoffe (Neurotransmitter) im Gehirn geklont. Geschafft hatte dies eine Arbeitsgruppe um Bettler, der damals noch bei Novartis tätig war. Damit stehen der Wissenschaft beide GABA-Rezeptoren für detaillierte Untersuchungen zur Verfügung: GABAA, schon länger und besser erforscht, und GABAB, das heute im Fokus der Forscherneugier steht.
Die GABA-Rezeptoren spielen eine entscheidende Rolle im empfindlichen Gleichgewicht von Aktivität und Ruhe des Nervensystems, weil der wichtige Botenstoff Gamma-Aminobuttersäure (GABA) an ihnen seine Wirkung entfaltet. GABA hemmt die Ausschüttung und Weitergabe verschiedener anderer Botenstoffe. Diese hemmende Wirkung ist wichtig, um die Nervenzellen nach erregter Aktivität zu beruhigen, zum Beispiel nach Stress auslösenden oder beängstigenden Erlebnissen. GABA-Rezeptoren finden sich auf fast allen Nervenzellen.
Psychische Krankheiten und Sucht: Verschiedene psychische Krankheiten werden heute als Störung des Gleichgewichts von Erregung und Hemmung verstanden und mit Wirkstoffen behandelt, die an GABA-Rezeptoren andocken. Die bekanntesten unter ihnen, zum Beispiel Valium, wirken via GABAA, während der GABAB-Rezeptor bisher die zweite Geige spielen musste. Nur zwei dort ansetzende Wirkstoffe werden von Menschen verwendet: GHB, das wegen seiner entspannenden, Angst lösenden und beruhigenden Wirkung bei Drogenkonsumenten gefragt ist und Baclofen, ein altbekanntes Medikament, das fast nur zur Behandlung von Muskelkrämpfen bei Spastikern eingesetzt wird. Die Palette könnte sich jetzt, da der GABAB-Rezeptor für Experimente zur Verfügung steht, erweitern.
Bettler und seine Mitarbeiter bei Novartis konnten vor fünf Jahren zeigen, dass zwei verschiedene Untertypen des Rezeptors existieren. Diese Erkenntnis wird die Pharmaforschung voraussichtlich dazu nutzen, Wirkstoffe zu entwickeln, die selektiv nur einen der zwei Untertypen beeinflussen und weniger Nebenwirkungen als GHB oder Baclofen haben könnten. Bettler denkt, dass möglicherweise auch die Wirkweise von Baclofen neu analysiert wird. Da es ebenfalls am GABAB-Rezeptor ansetzt, könnte es ähnliche Effekte wie GHB haben. Einerseits erweitert sich damit möglicherweise das therapeutische Anwendungsspektrum, anderseits könnte Baclofen aber auch Interesse auf dem Schwarzmarkt wecken. Im Gegensatz zu GHB ist Baclofen bisher aber noch nie in den Verdacht geraten, süchtig zu machen. Anhand von GHB wird klar, wie nahe Medikament und Droge oft beisammen liegen. Diese Nähe erklären Neurologen unter anderem damit, dass viele Substanzen in die Schaltkreise des Gehirns eingreifen, die auch an der Entstehung einer Sucht beteiligt sind – ganz besonders Medikamente für psychische Erkrankungen.
Das GABA-System spielt dabei eine wichtige Rolle: Es hemmt die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin. Dopamin beeinflusst das so genannte „Selbstbelohnungssystem” im Gehirn und sorgt dafür, dass wir angenehme Erlebnisse – ausgelöst zum Beispiel durch die Einnahme einer Droge – wiederholen wollen. Aus dem Drang nach Wiederholung kann eine unbeherrschbare Sucht werden, weil die Dopamin-Produktion unter dauernder Beanspruchung zurückgeht und die Dosis vieler Drogen regelmäßig erhöht werden muss, um die erwünschte Wirkung beizubehalten. Dabei verändert sich das Gehirn dauerhaft – die Sucht „brennt sich ein” (vgl. Suchtgedächtnis). GABA-Medikamente könnten den „Kick” vermindern, den suchtkranke Menschen beim Konsum ihrer Droge empfinden, und ihnen so helfen, von der Substanz loszukommen. Sowohl GHB als auch Baclofen werden deshalb für die Entwöhnung von Kokainsüchtigen erprobt. Diese Idee findet Bettler für GHB deshalb problematisch, weil der Wirkstoff selbst in den Verdacht geraten ist, süchtig zu machen. Bei Baclofen dagegen liegen bis heute keinerlei Hinweise auf ein Abhängigkeitspotenzial vor.
LG Federico
_________________
„Es gibt keine Alternative zum Optimismus,
Pessimismus ist Lebensfeigheit.“ Richard David Precht
|